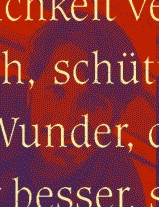
www.albrecht-reuss.de | Stand: 12.12.2008 | Impressum
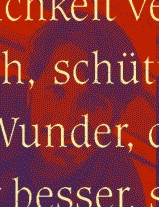
Ich bin ja nun ein Dortmunder, würde aber trotzdem
gerne weiterhin für Schwäbisches Publikum schreiben. Damit man
mich weiterhin verstehen kann, gebe ich zunächst einmal eine Einführung
in die Ruhrpöttische Sprache.
Diese ist zunächst sehr deutlich. So werden beispielsweise
„t“ und „s“ so gesprochen, wie man es im Süden in einem Chor zunächst
erlernen muß. Auch das „r“ und das „b“ sind gewöhnlich sehr
sauber gesprochen, wie auch das „c“, „d“, „f“, „h“, „j“, „k“, „l“, „m“,
„n“ und einige weitere Buchstaben. Das „ch“ wird gerne außerordentlich
betont. Das ist allerdings nicht allen Schwaben fremd, sagen doch einige
mit Vorliebe „welcher“ oder „Milch“ (leicht krächzend). Manchmal übertreiben
die Dortmunder es allerdings mit der Deutlichkeit, nämlich wenn es
um Vokale, also Selbstlaute geht. Diese ziehen sie gerne in die Länge,
verziehen sie in Richtung des „a“ - und was noch schlimmer ist: Sie sprechen
sie aus! Es gibt kein „essn“, „trinkn“ und „schlafn“ mehr, um nicht zu
sagen: Essa, tringa un’ schlofa.
Schlampig werden sie hier nur, wenn es um ein „g“ geht.
Da sagen sie schlicht „ch“ - Bahnsteich, Tach, Hühnerchechacker.
Die Wortwahl hingegen ist langweilig. Um ihre Befindlichkeit
auszudrücken, haben die Pötter nur zwei Möglichkeiten: scheiße
oder superscheiße. Und um einfachste Sachverhalte darzustellen, benötigen
die Menschen hier in der Folge viel zu viele Worte. Sagt zum Beispiel ein
Schwabe in einem Wort: „Gibsch-mol-bidde-dr-Buddr-rübr“, so benötigt
der Pötter schon neun: „Würdest Du mir mal eben bitte die Butter
rüberreichen.“
Wenn ein Schwabe – genauer: ein Schwabe, der stolz ist
auf seine Sprache – etwa nach Köln kommt (nur mal angenommen...),
kann er dort jede peinliche Unterhaltungspause beim Frühstück
mit einem einzigen Wort wegwischen: „’S-Xälz-isch-heit-abbr-läpprig!“
Und schon biegen sich die Frühstückenden vor Lachen. Man verabschiedet
sich mittlerweile schon in weiten Teilen Kölns mit „Adele“.
Am spannendsten ist es also immer dann, wenn unterschiedliche
Wortschätze aufeinanderprallen. „Gell“ kennt hier zum Beispiel niemand,
nich.
Um all diese oben beschriebenen Schwierigkeiten und Deutlichkeiten
in einer Sprache unterzubringen, ist eine gigantische Geschwindigkeit von
Nöten. Nach dem ersten Tag trug ich – beim Versuch, mit dem Tempo
mitzuhalten – einen schmerzhaften Muskelkater in der Wange davon. Ja, auch
dort gibt es Muskeln.
Doch wie überall gilt auch hier: Übung macht
den Meister. Ich für meine Person übe an 24 Stunden des Tages.
Und manchmal klappt es auch schon ganz gut. Als ich kürzlich am Bahnhof
eine Karte lösen wollte, konzentrierte ich mich schon lange vorher
auf meinen Satz: „Ich hätte gerne eine Fahrkarte nach Köln“ undsoweiter,
doch als ich schließlich an der Reihe war, kostete das „Ich hätte
gerne“ schon so viel Kraft, daß ich den ganzen restlichen Satz nicht
mehr wußte. Vielleicht schaffe ich es nächstes Mal schon bis:
„Ich hätte gerne eine“. Man darf nie zu früh aufgeben.
Um abschließend das Ruhrpöttisch noch anschaulich
darzustellen, werde ich versuchen, den ersten Absatz meines Textes so zu
schreiben, wie ihn ein Pötter lesen würde:
Ich binn ja nun ein Toatmunder, würde aberr trotztem
geane weiterchin für Shwebishes Puplikum shraiben. Tamit man mich
weiterchin vershtehen kann, gebe ich zunechst (nicht: zunäxt)
ainmal eine Ainführung in die Rruhrpöttishe Shprache.